Was unterscheidet eigentlich einen Fake von Fiktion? In unserer Welt wimmelt es inzwischen von Fake News, die uns auf die Palme bringen und politische Meinung manipulieren. Zugleich leben wir schon viel länger mit Fiktionen, die uns im Gegensatz zu Fake tatsächlich willkommen sind. Wie können „Erfindungen“ so gegensätzlich wirken? Zwei aktuelle Sachbücher ergänzen sich in ihrer Herangehensweise an das Phänomen des Fake:
In seinem Essay Fake und Fiktion. Über die Erfindung der Wahrheit beschäftigt sich Literaturwissenschaftler Thomas Strässle mit der Frage, wie ein Fake gearbeitet sein muss, damit er funktioniert. Strässle durchforstet die Erzähltheorie auf der Suche nach Antworten und baut zugleich ein Instrumentarium auf, mit der ein Fake untersucht werden kann.
Michiko Kakutani, langjährige Chefrezensentin der New York Times, arbeitet in ihrem Buch Der Tod der Wahrheit. Gedanken zur Kultur der Lüge detailliert auf, wie sich speziell die Kommunikation in den USA verändert hat. Kakutani zeigt, welche kulturellen Strömungen und welche gesellschaftlichen Veränderungen den Boden bereiteten, damit die Fake-Kultur der aktuellen US-amerikanischen Regierung überhaupt greifen konnte.
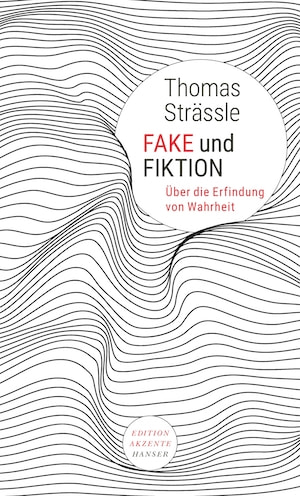
Der Fake, eine neue Kategorie
In der Regel nehmen wir Romane nicht für bare Münze. Jeder von uns weiß, dass Romane abzüglich realer Inspirationen das Ergebnis der Fantasie eines Einzelnen sind. Trotzdem gibt es hin und wieder Bücher, denen man auf den Leim geht (unabsichtlich z.B. Der kalte Saphir über eine fiktive Berliner Band, zu der Autor Michael Düblin erstaunlich viele Anfragen bekam / absichtlich z.B. Clemens Setz mit Indigo). Wie Erzähltechniken dieser Art funktionieren, kann ein Literaturwissenschaftler erklären. Im Buch stellt Strässle einige Bücher vor, die geschickt mit jenen Merkmalen spielten, die dem Leser typischerweise eine klare Zuordnung als Fiktion ermöglichen. So geschickt, dass sogar gewiefte Experten darauf hereinfielen.
Strässle ordnet den Fake als Spezialform der Fiktion ein. In der Literaturwissenschaft gibt es viele Wege, Fiktion zu beschreiben. Sie scheitert aber, will sie einen Fake erklären.
Strässle benötigt also Kriterien, die in dieser Form bisher keine literaturwissenschaftliche Bedeutung hatten. In seinem Essay stellt er sieben solcher Elemente zusammen. Ein Beispiel dafür ist die Identifikation mit dem Geschehen oder den Personen. Für ein Buch ist sie keine notwendige Voraussetzung, ein Fake ohne sie ist aber wirkungslos. Wenn Leser nicht den Eindruck haben, die Geschichte ginge sie persönlich etwas an und hätte ganz direkt Einfluss auf ihren Alltag, werden sie nicht darauf reagieren.
Die Manipulation von Quellen bzw. das Verzerren von Fakten als ziemlich offensichtliche Methode ist also beileibe nicht alles, um einen erfolgreichen Fake zu produzieren. Der Fake ist ein gezieltes Spiel mit Emotionen, Halbwissen, Öffentlichkeit oder Suggestion. Auf voller Länge mit Vorsatz und einem bestimmten Ziel. Mit einem Faktencheck alleine, so zeigt Strässle schlussendlich auf, ist es bei der Bekämpfung nicht getan. Die Frage, ob ein Fakt ein Fakt ist, macht tatsächlich den kleinsten Teil der Funktionsweise eines Fake aus.
Linktipp Facticious: Das Browserspiel, mit dessen Idee das Buch startet, stellt Nachrichten vor, die mit einem Klick in wahr oder falsch eingeteilt werden müssen. Es gibt mehrere Schwierigkeitsstufen und Highscores.
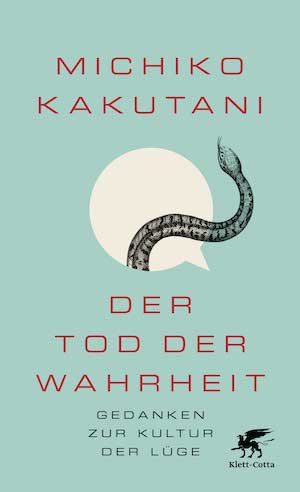
Über Kulturkämpfe und Ich-Kult
Michiko Kakutani lebt mitten drin im “Fake-Land“. Jenem Land, in dem augenscheinlich die Welle der alternativen Fakten und gezielten Lügen losgetreten wurde. Ihr Buch startet mit der aktuellen Lage im Land, bringt die Lügen des Präsidenten und die Vernebelungstaktiken der Regierung und ihrer Organisationen auf den Tisch. Von Beginn an stellt sie literatische und historische Dokumente dagegen, die schon vor Jahr(zehnt)en beängstigend genau vor eben jenen Ideen und demagogischen Verfahren warnten, die heute Realität sind: Hannah Arendt, Margaret Atwood oder George Orwell. Darunter auch ein gewisser Alexander Hamilton. Der beschrieb 1792 mit erschreckender Klarheit den zu fürchtenden Anführer mit Charakteristika, die heute der Präsident der Vereinigten Staaten auf sich vereint. Ein Mann „ohne Prinzipien im Privatleben“ und mit „vorlautem Temperament“, der sich „schmeicheln lässt und auf allen Unsinn der Eiferer seiner Zeit hereinfällt“.
Kakutani verfolgt die Entwicklung zurück zu denkbaren Ursprüngen. Finanzkrise, Globalisierung oder Technologisierung sind da vielleicht Auslöser, aber keine Ursache. Die liegt ihrer Beobachtung nach an anderen Stellen. Kakutani verlässt an dieser Stelle zwar nicht die USA als ihren Beobachtungsort, ihre Analyse ist dennoch nicht landesspezifisch: Der „paranoide Stil“ von Politik oder Gesellschaft komme in Wellen immer wieder und benötige einfach nur eine Gelegenheit dazu. Eine Gelegenheit bietet sich, wenn Tatsache und Meinung nicht mehr sauber unterschieden werden.
Unwissenheit und Ignoranz waren auf einmal modern. „Wenn die Bürger sich nicht mehr die Mühe machen, sich Grundkenntnisse über die Themen anzueignen, die ihr eigenes Leben betreffen, […] geben sie die Kontrolle […] auf, ob es ihnen gefällt oder nicht.“
Genau hier setzt übrigens ein Element des Fake an, wie Thomas Strässle in seiner Analyse feststellt. Ein Fake ist darauf angewiesen, dass das Grundwissen zu bestimmten Themen bei ausreichend vielen Menschen zu gering ist und auch kein Wille besteht, das zu ändern. Es muss nur groß genug sein, dass überhaupt Interesse an einer Meldung besteht. Jene, die an Chemtrails glauben, fallen deshalb ebenso auf Fake herein wie Anhänger der Demagogen. Wir können es uns gesellschaftlich nur nicht leisten, beide als harmlose Spinner abzutun.
Der Tod der Objektivität
Einen wichtigen kulturellen Ursprung haben die Methoden und die Denkweise der politisch Rechten ausgerechnet bei den politisch Linken, so Kakutani, „eine paradoxe Entwicklung“. Deren Kulturkämpfe während der 1960er hätten die Ideen der Aufklärung, die Ideale von Vernunft und Wissenschaft als reaktionäres, patriarchalisches Gedankengut abgetan. Ein damals kleiner Kreis vom Postmodernisten trieb das auf die Spitze und behauptete, es gebe gar keine ojektive Realität. Eine Ideologie, die heute dankbar aufgegriffen wird, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse krachend an die Wand geklatscht werden, um persönlichen Interessen den Vorzug zu geben (zu Lasten der Allgemeinheit freilich).
Michiko Kakutani findet viele Beispiele (u.a. auch in der Werbung), wo gezielt damit gearbeitet wird, Wahrheit durch Plausibilität zu ersetzen. Viele Trump-nahe Medienanbieter versuchen nicht einmal, Informationen zu liefern. Die Inhalte drehten sich vielmehr um „wahrheitsbasierten Content“, mit dem gezielt Narrative aufgebaut werden. „Das Ergebnis ist ein Umfeld, in dem der Präsident auf einen Terroranschlag in Schweden anspielen kann, der niemals stattgefunden hat.“ Hier gehen beide Sachbücher ebenfalls Hand in Hand: Plausibilität ist eines der sieben Elemente, die Strässle zur Beoabchtung und Beurteilung von Fake festlegt.
Eine Rolle spielen zusätzlich die modernen Medientechnologien, die den Zugang zu Informationen ursprünglich vereinfacht hatten. Heute findet jeder ein zerstückeltes Medienumfeld, das die (manchmal bewusste, manchmal unbewusste) Abschottung und Silo-Bildung möglich macht. Algorithmen unterstützen das, von den Social Media bis hin zu Suchmaschinen. Je nachdem, wie sich ein Nutzer beim Suchen profiliert, könnten zum Beispiel Mitarbeiter einer Ölfirma andere Suchergebnisse zum Klimawandel erhalten als Umweltaktivisten.
Soziale Medien […] verstärken nicht nur die Polarisierung, sondern untergraben häufig auch das Vertrauen in Institutionen und erschweren die faktenbasierten Debatten und Diskussionen, die in einer Demokratie unentbehrlich sind.
Wege aus der Krise?
Fake News den Hahn abzudrehen, ist keine einfache Aufgabe. Um zum Beispiel die erwähnten Silos aufzubrechen, müssten unter anderem Algorithmen verändert werden. In einer Zeit, in der Informationen monetarisiert werden, müssen Wege und Wille dazu erst einmal geschaffen werden. Mit Longreads mit geringem Klickpotenzial verdient es sich eher schlecht. Es spielen weiterhin psychologische Phänomene eine Rolle, die sich kaum aus der Welt schaffen lassen. Menschen neigen dazu, die erste Information zu akzeptieren, die sie zu einem Thema erhalten. Je mehr widersprüchliche Informationen danach kommen, umso stärker ist der Effekt. So etwas machen sich Trolle zunutze.
In der modernen Propaganda geht es nicht nur darum, falsch zu informieren oder ein Ziel voranzubringen. Es geht darum, das kritische Denken zu ermüden und die Wahrheit zu vernichten.
… zitiert Kakutani den Schachweltmeister und heutigen Aktivisten Garri Kasparow. Das Ergebnis sind Zynismus und Resignation, egal, ob die Propaganda in Russland, den USA oder hierzulande zuschlägt. Hat man einmal verstanden, dass die Autokraten genau darauf angewiesen seien, kenne man eines der wichtigsten Gegenmittel, so Kakutani: Sich stetig gegen Resignation wehren. Ein zweites Gegenmittel ist unbedingt die Freiheit der Presse. Nicht umsonst ist die Presse überall auf der Welt das erste Ziel, das Autokraten zum Schweigen bringen wollen.
So unterschiedlich die Perspektiven sind, aus denen heraus sich Strässle und Kakutani mit Fake befassen, so gut fügen sich die beiden Titel zusammen. Strässles sieben Fake-Elemente tauchen früher oder später ebenso in Kakutanis Beobachtungen auf … oder umgekehrt. Ein guter Beleg dafür, was ich zuvor schon erwähnt habe: Kakutani mag sich schwerpunktmäßig mit den USA befassen, Fake selbst funktioniert überall identisch und ist überall eine Bedrohung demokratischer Strukturen. Kakutani beschreibt zusätzlich das Handwerkszeug, mit dem Demagogen bestens umzugehen wissen. Eine empfehlenswerde Buchkombination: Kennt man die Fake-Mechanismen, ist man in der Arbeit gegen Fake bereits einen Schritt weiter.
Bibliografische Angaben
Thomas Strässle – Fake und Fiktion. Über die Erfindung von Wahrheit
Verlag: Hanser
ISBN: 978-3-446-26229-4
Erstveröffentlichung: 2019
Michiko Kakutani – Der Tod der Wahrheit. Gedanken zur Kultur der Lüge
Verlag: Klett-Cotta
ISBN: 978-3-608-96403-5
Originaltitel: The Death of Truth. Notes on Falsehood in the Age of Trump
Erstveröffentlichung: 2018
Deutsche Erstveröffentlichung: 2019
Foto: Elijah O’Donnell, unsplash
Buchtipps bestellen bei buecher.de* / genialokal.de* / buchhaus.ch* / osiander.de* / orellfuessli.ch* / amazon.de* (*Affiliate-Links)