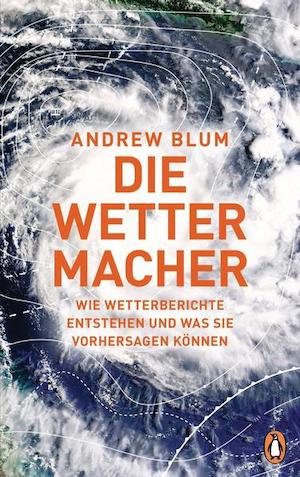
Nachdem ich bei Friederike Otto in Wütendes Wetter eingetaucht war, wollte ich über die Wettermodelle einfach mehr wissen. Mit dem Untertitel „Wie Wetterberichte entstehen und was sie vorhersagen können“ sieht Andrew Blums Buch „Die Wettermacher“ nach einer perfekten Fortsetzung aus. Nun, nicht ganz, der Untertitel führt etwas in die Irre (mich jedenfalls).
Andrew Blum hat sich auf die historische Spur der Wettervorhersage gesetzt und verfolgt, wie sich erste Ideen für eine geordnete Vorhersage in der Mitte des 19. Jahrhunderts abzeichneten. Weit weg von Bauernregeln gab es Menschen, die Wetterdaten bestimmten und sich fragten: Wenn die Atmopshäre den Gesetzen der Physik gehorcht, könnte man mit den jetzigen Werten dann nicht auch künftige Werte über Gleichungen vorherbestimmen? Man begann, unterstützt vom neu erfundenen Telegrafen, Daten von den verschiedensten Beobachtungspunkten zusammenzutragen. Erste Gleichungssysteme wurden entwickelt, um Wetterdaten miteinander zu verknüpfen.
Mehr Daten, mehr Rechengeschwindigkeit
Doch die „Wettermacher“ hatten zunächst große Probleme: Zu wenig Daten, zu wenig (menschlich) Rechenleistung. Über Jahre gab es dafür auch keine Lösung. Erste sinnvolle Vorhersagen kamen erst um den 1. Weltkrieg herum, als norwegische Meteorologen in Bergen weniger Gleichungen lösten, als nach Bewegungsmustern in der Atmosphäre suchten.
Welche Befriedigung sollen wir aus der Fähigkeit ziehen, das morgige Wetter vorherzusagen, wenn wir ein Jahr brauchen, um es zu berechnen?
Vilhelm Bjerknes, norwegischer Wetterpionier
Blum setzt die Geschichte von Wetterbeobachtung und Vorhersage fort mit den ersten Versuchen, über Flugzeuge Daten aus höheren Luftschichten zu bekommen und wie später Satelliten (inzwischen ein paar Dutzend) diese Datensammlung übernahmen. Gerade bei den teuren Satelliten half ein Nebeneffekt: Die militärische Nutzung von Wetterdaten brachte die zivile Nutzung maßgeblich voran. Ohne dieses Interesse wäre manches Mal weniger Geld in Technologie oder Entwicklung gesteckt worden. Heute sind tausende von Wetterstationen über die Welt verteilt. Meeresbojen schaffen ebenso Daten herbei wie Messinstrumente in Flugzeugen. Die Kunst ist es, all diese Daten richtig zusammenzubringen und sie in Modelle für die Prognosen einzuspeisen.
Die Wetterdiplomaten
Einen Aspekt bei den Wetterprognosen macht man sich für gewöhnlich gar nicht bewusst: Da das Wetter vor Grenzen nicht Halt macht, muss auch der Datenaustausch international funktionieren. Um das zu gewährleisten, gibt es praktisch seit Beginn der Prognosebemühungen auch einen intensiven politischen Austausch. Die nationalen Wetterdienste arbeiten zusammen, tagen gemeinsam und forschen an denselben Instituten, egal, woher sie kommen.
Doch auch das weltumspannende Netz der Metorologen, Atmosphärenforscher, Hydrologen oder Physiker steht vor einer neuen Herausforderung. Wie arbeiten die Wettermacher weiter, wenn sich zunehmend private Firmen in der Prognose tummeln? Die amerikanische Weather Company zum Beispiel ist anders als nationale meteorologische Zentren ein Profitunternehmen. Sämtliche Apple-Mobiltelefone zum Beispiel haben standardmäßig die App der Weather Company vorinstalliert. Dabei wäre ein nationaler Wetterdienste übrigens oft besser in der Prognose (Wettervorhersage / Wikipedia; Plotsh: Schweizer Wetter-Apps mit präzisen Daten / iPhone-Blog). Theoretisch könnten auch Millionen von Sensoren in Handys oder Autos zur Datengewinnung herangezogen werden. Nur: Wem gehören die Daten dann? Eine Lösung zeichnet sich dafür noch lange nicht ab.
Wie entstehen Wetterprognosen nun wirklich?
Wie Wetterberichte tatsächlich entstehen, verrät dieses Buch nicht. Der Untertitel ließ mich etwas anderes erwarten. Nämlich, dass Blum die Modelle erklärt, ihre Funktionen und Bestandteile. Die Probleme beim Aufbau der Modelle und warum sie ungenauer werden können, wenn zu viele Daten eingespeist werden. Welche Rolle Temperaturen spielen und welche der Luftdruck. Welche geografischen Merkmale einen Einfluss haben und wie so etwas eingebaut wird. Doch genau dazu gibt es keine Erläuterungen.
Andrew Blums Buch liefert einen historischen Abriss der Wettervorhersage. Mit Blick darauf ist das Buch ein gutes Sachbuch und sehr interessant. Es ist nur wirklich nicht das, was ich hinter dem Untertitel erhofft und mir gewünscht hatte.
Bibliografische Angaben
Verlag: Penguin
ISBN: 978-3-45343-780-7
Originaltitel: The Weather Machine
Erstveröffentlichung: 2019
Deutsche Erstveröffentlichung: 2019
Übersetzung: Stephan Gebauer