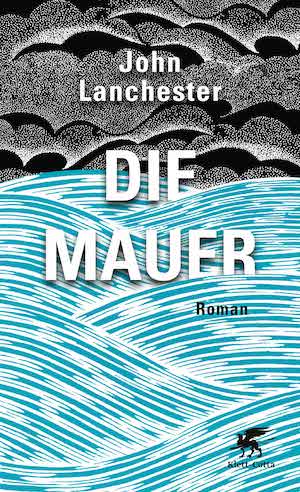Spricht man über Klimaschutz, ist „Bäume pflanzen“ ziemlich oft auf der Themenliste. Schließlich verbrauchen sie CO2 und müssten daher optimale Helfer auf dem Weg zur Milderung der Klimakatastrophe sein. In gewisser Weise sind sie das auch, aber nicht so, wie man sich das gemeinhin vorstellt. Neben dem Wald, an den Europäer:innen wohl als erstes denken, spielen auch Moore und Meeresflora eine große Rolle. Bernhard Kegel zeigt in seinem Buch, wie Pflanzen mit Photosynthese arbeiten und stellt anhand verschiedener Ökosysteme weltweit vor, wie wir beim Kampf gegen den Klimawandel damit arbeiten können.
Das Buch landete 2024 auf der Nominiertenliste des Deutschen Sachbuchpreises.
Der Titel ist so plakativ, wie das Buch differenziert ist: […] die Existenz von Anstrengungen rund um den Globus, in Europa, China, USA oder Afrika, seien es Moorkulturen in Schleswig-Holstein, Tangwälder im Ozean oder Aufforstungen im Sahel, machen Mut. Der Autor verspricht nicht die eine Lösung, er zeigt Wege auf und reflektiert diese.
Aus der Jurybegründung zur Nominierung für den deutschen Sachbuchpreis 2025
Den CO2-Ausstoß senken, ist nur ein Baustein auf dem Weg zu einer künftig noch halbwegs lebenswerten Umwelt. In Teilen muss das Gas zusätzlich aus der Luft geholt werden, weil zu viel von der Industrie abgegeben wurde. Denn, darauf macht Kegel gleich zu Beginn aufmerksam, wissen wir nicht nur schon unglaublich lange über die Klimaprobleme Bescheid. Politik und Wirtschaft haben auch ebenso lange nichts unternommen: „Mehr als 80 Prozent der weltweiten Kohlendioxidemissionen sind erst in den letzten 30 Jahren in die Atmosphäre gelangt“, schreibt der Autor. Die Anstrengungen einer CO2-Reduktion würden sich allerdings umgehend lohnen. Die Übergangszeit nach einer Nullreduktion würde nur wenige Jahre dauern (und nicht jahrzehntelang, wie man früher dachte).
Perfekte Helfer und ihre Grenzen
Pflanzen haben das Prinzip von „Carbon Capture“, das unter anderem in Island für großtechnische Anlagen entwickelt wird, perfektioniert. Inklusive den ergänzenden Boni, dass sie ganz nebenher Schatten spenden, Lebensmittel liefern oder mit ihrer Biomasse teilweise unseren Energiebedarf decken können. Alleinretter seien Pflanzen nicht, so Kegel, schließlich sei die Herausforderung dafür inzwischen zu groß, aber sie liefern dank ihrer vielen Einsatzmöglichkeiten einen ganz entscheidenden Baustein.
Um die Hilfe richtig einordnen zu können, zeigt Kegel zunächst einige Grenzen dessen auf, was zur Vermeidung ernsthafter Maßnahmen in Politik und Industrie zwischenzeitlich als „Pluspunkt“ gehandelt wurde. Die CO2-Düngung zum Beispiel durch den erhöhten CO2-Gehalt in der Luft, oder „einfach mehr Bäume pflanzen“ — vor allem vor dem Hintergrund, dass zahlreiche Länder gleichzeitig massiv abholzen für Bebauung bis Plantage. Ein Kapitel widmet das Buch daher dem großen Wert des Walderhalts und der Frage, wie sich effiziente und nachhaltige Aufforstung gestalten lässt.
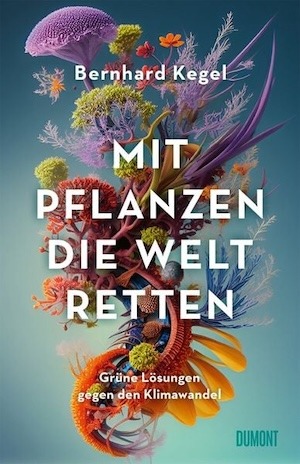
Große „Player“: die Moore
Einer der besten Helfer sind Moore: Weltweit gesehen speichern sie Kohlenstoff fast doppelt so gut wie alle Wälder zusammengenommen. In Deutschland sind von einst 1,8 Millionen Hektar noch rund 30.000 Hektar übriggeblieben. Nasse, lebendige und Photosynthese betreibende Moore sind Kohlenstoffsenken; doch legt man sie trocken, werden sie zu „Kohlendioxidschleudern“.
Meliorierte Moore sind für 6 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich — das ist mehr, als der gesamte Flugverkehr verursacht.
Auf nur 7 Prozent der Agrarfläche sorgen sie für 37 Prozent der landwirtschaftlichen Emissionen. In anderen Ländern ist das Verhältnis sogar dramatischer, wie in Rumänien (4 zu 49), Lettland (6 zu 71) oder Finnland (12 zu 62). Trockengelegte Moore sind nur wenige Jahre sinnvoll nutzbar, danach sorgen sie eher für Nachteile. Sie sind massiv erosionsgefährdet, liefern wenig Ertrag und sacken obendrein ab. Dass die Niederlande heute so deutlich unterhalb des Meeresspiegels liegen, liegt enorm an der gezielten Austrocknung der dortigen Böden.
In Deutschland werden einige Flächen seit Jahren vorsichtig wieder vernässt. Der Erfolg? Der CO2-Ausstoß dieser Flächen sinkt sofort und effektiv auf Null. Eine wunderbare Maßnahme freilich. Doch Bernhard Kegel weist der Politik nach, dass sie nur halbherzig unterwegs ist. Denn nach wie vor fließen Fördergelder an Bauern, die trockengelegte Moore bewirtschaften. Dabei, so stellt der Experte klar, kann man auch mit nassen Mooren Landwirtschaft betreiben: mit „Paludikultur“. Finanziell muss die Verässung also keinen Verlust bedeuten. Landwirtschaft funktioniert anders, aber sie funktioniert. Allerdings ist sie nicht einmal als landwirtschaftliche Nutzung anerkannt. Zeitgemäße Politik sieht anders aus, so Kegel.
Was das Wasser leisten kann
Von den meisten unbemerkt, haben die Ozeane in den vergangenen Jahrzehnten bereits still geholfen. Bereits ein Drittel des menschengemachten Mehr an Kohlendioxid haben sie in marinem Leben und in Sedimenten aufgenommen. Dieser nach der Meeresfarbe benannte „blaue Kohlenstoff“ übertrifft hinsichtlich der Menge jene an Land bei Weitem. Aber auch hier gibt es natürliche Grenzen. Dennoch ist es wichtig, sich mit Sedimentierung oder Meerespflanzen zu befassen. Bernhard Kegel erklärt ebenso anschaulich wie detailliert, welche großartigen Kohlenstoffspeicher zum Beispiel Seegräser sind: Sie speichern im Schnitt mehr als 30-mal soviel Kohlenstoff wie Wälder auf derselben Fläche.
Auch hier gilt: Der Aufbau von Neuem ist nur dann nachhaltig, wenn zugleich noch bestehende Ökosysteme erhalten werden. Dazu zählen im Bereich des „Blue Carbon“ auch Tangwälder oder bedrohte Mangroven.
Ganz zum Schluss kümmert sich Kegel auch um eine technische Lösung: Was wäre, wenn man selbst Photosynthese zum Binden von CO2 durchführen könnte? Es gibt tatsächlich diverse Ansätze, die aber kaum über den Status von Machbarkeitsstudien hinausgekommen sind. Die Zeit, auf eine mögliche Skalierung zu warten, gibt es nur nicht. „Mit Pflanzen die Welt retten“ macht den bestehenden Konsens deutlich: Die eine alles rettende Maßnahme gibt es nicht, um CO2-Ausstoß und -Gehalt zu senken. Es müssen alle an einem Strang ziehen und viele Lösungen gleichzeitig angegangen werden:
Wir können nicht warten, bis alle Fragen ins letzte Detail geklärt sind. Die Zeit drängt. Probleme werden am besten dann gelöst, wenn sie sich auf dem eingeschlagenen Weg stellen.
Die Pflanzen sind auf diesem Weg also nur ein Baustein von vielen, aber ein eminent wichtiger. Bernhard Kegel zeigt ausführlich, welche Optionen zur Verfügung stehen und wie sie am besten einsetzbar sind — eine wichtige Übersicht, denn über die Wege zu mehr Klimaschutz müssen die Informationen so vielen Interessierten wie möglich zur Verfügung stehen.
Bibliografische Angaben
Verlag: Dumont
ISBN: 978-3-8321-6850-6
Deutsche Erstveröffentlichung: 2024