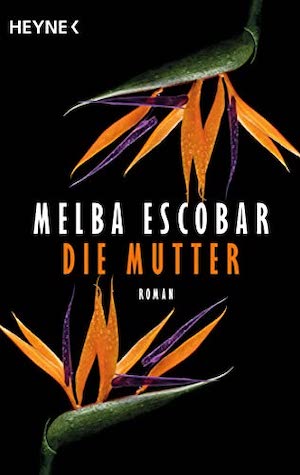
In einem Einkaufszentrum im kolumbianischen Bogotà explodiert ein Sprengsatz auf der Damentoilette, es gibt Tote und Verletzte. Während Cecila in den Krankenhäusern sucht, ob ihr Sohn Pedro zu den Verletzen oder Toten gehört, zeigen die Nachrichten bereits Fotos der Verdächtigen – Pedro ist mit dabei. Dabei wollte er dort eigentlich nur ein Geschenk kaufen – oder etwa nicht?
Melba Escobar erzählt die Stunden nach dem Anschlag aus Perspektive der Mutter: Cecilia wechselt zwischen dem Jetzt, in dessen Nachrichten Verhaftungen und Spekulationen wuchern und Freundschaften auf dem Spiel stehen, und dem Gestern. Pedros Mutter erinnert sich an dessen Vater und die Jahre, in denen sie Pedro alleine groß gezogen hat. Sie blendet dabei regelmäßig den politischen Terror ein, dem Kolumbien ausgesetzt war und immer noch ist. Es gibt im Land niemanden, der nicht Tote oder Vermisste in seiner Familie kennt. Zu ihnen gehört auch Pedros Vater, der schon vor dessen Geburt nicht mehr von einer Reise zurückkehrte.
Die innere Gewissheit
Vieles hat die Mutter Pedro nicht erzählt. Von der Art, wie sein Vater ums Leben kam, weiß er nichts. Zumindest nicht von Cecilia, die sich von der politischen Gewalt gerne lösen möchte. Vielleicht hat er vom Onkel etwas erfahren, der immer engagiert war und selbst bei einer Rebellengruppe gekämpft hat. Cecilia fragt sich nun, ob sie ihren Sohn gut genug kennt, der sich als Student nicht mehr so intensiv mit ihr ausgetauscht hat wie früher. Was hat ihm der Onkel erzählt und wie hat ihn die Uni verändert?
Schnell machen Gerüchte die Runde, der Anschlag sei von der Militärregierung selbst inszeniert, um die Universitäten des Landes zu diskreditieren. Viele Indizien sprechen dafür; so auch die Frage, woher die Nachrichten so schnell Pedros Foto hatten. Cecila ist gezwungen, ihre eigenen Bekanntschaften auf den Prüfstein zu stellen.
„Sie müssen Ihrem Sohn vertrauen. Er weiß, was er tut.“
„Ich vertraue ihm. Aber ich vertraue der Justiz nicht.“
So unübersichtlich wie die Situation
Melba Escobar lässt Cecila zwischen verschiedenen Erinnerungsebenen, unterschiedlichen Personen und dem Heute springen (ein Stil, den sie auch in „Die Kosmetikerin“ eingesetzt hat, wie Kaliber.17 schreibt). Das wäre ganz sicher auch die Art, wie sich jede andere Mutter in so einer Situation Gedanken machen würde. Innerlich sich windend, sich sicher wähnend, das eigene Kind zu kennen und zugleich einem enormen Druck von außen zu spüren. Um sich doch wieder hundertprozentig sicher zu sein, dass Pedro solche eine Ungeheuerlichkeit niemals mitmachen würde.
Das unübersichtliche Erzählen gerät zum Spiegel dieser unübersichtlichen Situation. Ob diese Analogie von Escobar in „Die Mutter“ allerdings Absicht war, bezweifle ich. Bis zum Ende jedoch hatte ich bei jedem Sprung Schwierigkeiten damit, mich in die richtige Ebene zu denken. Mit welcher Person tritt die Mutter nun wieder in den inneren Dialog? Mitunter brauchte ich mehrere Seiten dafür.
Doch eben noch ein Schlusswort: Die absurd korrupte Politik und die so absurde tägliche Gewalt in Kolumbien ist in den Nachrichten eine kaum vertretene Welt. So fern es scheinen mag, sehe ich aber eine universelle Idee in Escobars Roman: Man sollte es in keinem Land erst einmal so weit kommen lassen; auf sich allein gestellt gibt es für ein Land über lange Jahre praktisch kein Entkommen.
Buch bestellen bei buecher.de* / buchhaus.ch* / osiander.de* / orellfuessli.ch* / genialokal.de* (*Affiliate-Links)
Bibliografische Angaben
Verlag: Heyne
ISBN: 978-3-453-42610-8
Originaltitel: La mujer que hablaba sola
Erstveröffentlichung: 2019
Deutsche Erstveröffentlichung: 2023
Übersetzung: Sybille Martin
Über Fake und Fiktion
Zwei Sachbücher von Thomas Strässle und Michiko Kakutani über politisch motivierte Fake News und „alternative Wahrheiten“